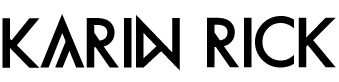Reigen – The making of a post-pornografic Schnitzler im Werk X, durchaus sehenswert.
Travestie, queerer Sex, Fetische, schillernde Schaubühnenatmosphäre und ein Panoptikum lesbischer, bisexueller und transsexueller Charaktere wird derzeit im Werk X unter der Leitung von Yosi Wanunu präsentiert – zeitgleich zum 250 jährigen Jubiläum des Wiener Praters, der selbst Schnittstelle von Realität und Illusion, Traum, Theater und Verzauberung ist. Durch und durch Wienerische Besonderheiten werden uns aufgewartet.
In der Mitte der Bühne der leere, von Glühbirnen gesäumte Rahmen eines überdimensionalen Schminkspiegels als Bühne in der Bühne, dahinter sechs weitere kleinere, an denen die Schauspielerinnen mit dem Rücken zum Publikum sitzen, sich zurechtmachen, bald von sich erzählen, die Dialoge Schnitzlers monologisch weiterführen, aus dem Nähkästchen eigener sexueller Habits plaudern werden. Nostalgische Walzerklänge, bis der erste Dialog des Reigens beginnt, der schwarze Rahmen sich belebt.
Komm, mein schöner Engel. Leutnant und Dirne begegnen einander im Niemandsland. Nur wer ist wer? Der Soldat ist eine Blondine im Minirock. Die schreitet forsch aus und einher. Die Dirne ist ein Mann in Jeans, mit Brillen, Kurzhaarschnitt. Der schleicht sinnlich dahin. Die Begegnung endet in zu pumpenden Technorhythmen mechanisch hin und her zuckenden Bewegungen der Köpfe, der Oralverkehr wird mit Fingern frech gemimt.
Sie, jetzt schrei‘ ich aber wirklich, schnurrt wohlig Marie, in knallengen roten Hosen mit Tigerprint, und schmiegt sich an die Blonde im Minirock, die ihre Brüste walkt und seufzt, sag Franz zu mir, Marie. I never promised you a rose garden, singt sie, während sie in lakonischer Geste Maries Bluse zerschneidet, dazu rosa Bühnenlicht.
Dann beide ab, Schnitt, Rückkehr zu den Schminktischen, ins post-schnitzlerische Jetzt. Die Blonde spricht zu ihrem Spiegelbild. Wir werden herausgerissen aus dem Wien des fin de siècle in die nächtlichen Umtriebe einer Schauspielerin von heute. Harter Lesbensex, schneller Fick am Klo in schmuddeligen Lokalen.
Sie sind sehr nett angezogen, Marie. Ist vielleicht die Köchin zu Haus? Der junge Herr ist eine junge Frau mit dunkler Haut in weißem Hemd und schokobrauner Hose. Und ist schüchtern. Marie trägt eine durchsichtige schwarze Bluse zu ihren knallengen roten Jeans und ist kokett. Sie tänzelt lange lasziv um den jungen Herrn herum als sie den gewünschten Tee bereitet, ein Zuckerstück in hohem Bogen in die Tasse wirft, um sich dann hinter ihn zu stellen und die klare, goldene Flüssigkeit in seinen Schoß zu gießen. Die ursprüngliche Nötigungssituation wird umgedreht, das Dienstmädchen als Domina, der Tee – golden shower.
Und was erzählt Marie, wenn sie alsbald wieder vor dem Schminktisch sitzt? Welche Träume sollen wahr werden, welches Leben besticht in der Gegenwart? Ich steh halt auf ältere Damen, teilt sie mit, und such mir bald eine Millionärin, die mir, weil ichs ihr so gut besorge, ihr Haus, besser ihr Schloss vermacht. Einmal Besitzerin desselben werde ich damit nur Gutes tun. Robin Hood, nur lesbisch.
Die in knappen Zügen, oft nur körpersprachlich angespielten zehn Dialoge des „Reigens“ stellen eine lose Verbindung zu den Geschichten der Schauspielerinnen im Hier und Jetzt her und diese sind es, die die post-pornografische Intention umsetzen. Doch was genau heißt das? Statt sozialer Unterschiede zwischen Proletariat, Kleinbürgertum, Bürgertum, Boheme und Aristokratie steht queer als üppige Unterfütterung sexuellen, zeitgenössischen Techtelmechtels. Sei es die auf Toiletten fickende Lesbe als Soldat, oder die soeben aus Lesbos zurückgekehrte Bisexuelle, die in Lockenwicklern die junge Frau spielt und den drallen Körper ungeniert entblößt um sich Honig auf die Möse zu streichen. Das „süße Mädel“ wird von einer Transgender Akteurin im Matrosenanzug verkörpert – Lucy McEvil in einer Glanzrolle, die für diesen Akt jedoch auf ihr langes, seidiges Haar verzichtet und das junge Ding ohne Namen lieber mit Vollglatze und ungeschminkt darstellt, um sich wenig später, vor dem Spiegel, der das eigene Ich erbarmungslos wiedergibt, mit diesem Mädel zu vergleichen, ja in Bitterkeit zu verbünden. Der riskante Charakter beider Lebensentwürfe springt uns erbarmungslos in dem Satz entgegen: „Das süße Mädel hat nicht einmal einen Namen. Ich habe einen, ich habe ihn mir selbst gegeben. Ich bin eine Transe.“
Da liegt die junge Frau in Lockenwicklern mit dem Gatten im Bett und verhandelt Leidenschaft, doch eigentlich sind’s ja zwei Frauen, die steif nebeneinander auf dem harten Lager Platz genommen haben. Als Insiderin könnte man nun ebenso gut glauben, einer schonungslosen Demaskierung des „lesbian bed death“ beizuwohnen. Die Art, wie die eine sich ihrer Hosen entledigt, ist von unüberbietbar lusttötender Peinlichkeit.
Der Reigen, das Drama, das einst zum größten Theaterskandal des 20. Jahrhunderts wurde, gleitet ganz und gar unbehelligt queer ins Wien des dritten Jahrtausends. Denn alles Sexuelle ist längst öffentlich, bekannt, besprochen, erforscht und erlaubt, audio-visuell präsent und ganz und gar nicht mehr schockierend oder verboten.
Die existentielle Dimension der Inszenierung gelingt daher nicht im perlenden, expliziten Abspulen aller möglicher Praktiken sondern in der Sichtbarmachung des prekären, irritierenden Charakters, den diese immer noch haben. Das zeigt sich darin, dass Dress- und Verhaltenscodes der Ursprungsfiguren so schnell und so lang durchmischt werden, bis nicht mehr klar ist, wer zu wem in wessen Namen spricht, wer wen in welcher Gefühls- und Gemengelage darstellt.
Die bürokratische Nüchternheit, mit der Sex heute mitunter verhandelt wird, stimmt jedoch nachdenklich. Die Verführungskunst der Schnitzler’schen Figuren, ihr Wunsch nach Illusion, nach der Vorspiegelung einer Wunschwelt zumindest in Worten, „ich dürfte gar nicht hier sein“, „ich geh gleich wieder“, „ich bin nicht so eine wie Sie denken“, „sag, hast du mich lieb“, „war vor mir schon eine andere da?“, diese Ars Amandi also, die Lüsternheit und Erotik erst entstehen lässt, ist verschwunden. Statt dessen wird eine potentielle Partnerin politisch korrekt darauf hingewiesen, dass ein Klofick keine romantische Fortsetzung zulassen wird. Und auf eine solche Weise auch nicht kann.