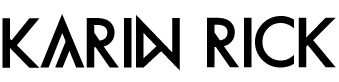Her Story is a Hair Story – Karin Rick über Louise Rick
Mit Haut und Haar – die Jahresausstellung 2018 im Wien Museum würdigt die Geschichte der Haarkunst und ihre Akteur_innen.
Ich freue mich besonders, dass die Haarkreationen meiner Mutter, Louise Rick, in dieser Ausstellung gezeigt werden. Louise Rick erlangte in den 50er Jahren internationale Bekanntheit mit ihren zarten, luftigen Haarschöpfungen, die die Mode der 50er und 60er Jahre prägten. Sie gewann drei Weltmeisterschaften. Die Stadt Wien verlieh ihr mehrmals den Modering, 1962 wurde sie mit dem Staatspreis ausgezeichnet.
Im Katalog der Ausstellung erschien das nachfolgende Porträt von Louise Rick.
Internationales Schaufrisieren in Amsterdam: Sie steht auf dem Laufsteg, ein Paar Haarclips cool in die Mundwinkel geklemmt, wie Lauren Bacall eine Zigarette zwischen den Lippen halten würde. Die eine Hand schwebt über dem, vor ihr geneigten blonden, lackglänzenden Kopf des Models, das in weißem Taft und Tüll vor ihr sitzt, mit der anderen bringt sie die letzten Retuschen an einer Frisur an, die nicht nur in Branchenkreisen für Sensation sorgen wird. Ihr Blick, mit dem sie ihr Werk taxiert, verrät die Konzentration des Routiniers, dem nur die eigene Arbeit wichtig ist.
Pressegespräch in ihrem neueröffneten Frisiersalon in der Wiener City: Umgeben von Fotografen, Journalisten und Fachleuten erklärt sie die Finessen jener Frisur, mit der sie eben den Worldcup in Wien gewonnen hat und damit über Nacht zum Star wurde. Auch wenn sie für dieses Foto, das in die Weltpresse gelangen wird, posiert, nimmt sie die selbstvergessene und nur auf ihre Arbeit gerichtete Haltung der Künstlerin ein.
Mit ihren feinen Gesichtszügen und der Eleganz ihrer Kleidung könnte sie direkt aus einem Hollywoodfilm entsprungen sein – meine Mutter, für mich Ikone der 50er Jahre. Begabt, ehrgeizig und erfolgreich, und so schön, dass sie sich optisch nie von den Models unterschieden hat, die sie frisierte. Pionierin in einem Männerberuf, einzige Frau in der österreichischen Nationalmannschaft – in jenem „Wunderteam“, das 1954, 1956 und 1958 dreimal hintereinander die Weltmeisterschaften im Frisieren gewinnen und damit unerwartet und erstmalig die, in Frisur und Mode so übermächtigen Franzosen schlagen wird. Die „großen Fünf“ wie die Presse dieses Team tituliert. Ihr Name, Louise Rick ist danach für Jahrzehnte nicht mehr wegzudenken aus dem Reich der Figaros, die bis dato die Alleinherrschaft über das Styling von Frauenköpfen ausübten.
Nicht nur die Herren Createure und Friseure selber mussten ihr neidvoll das Feld räumen, ihre Fantasie und ihr Können siegten über die Klüngelwirtschaft der männlich dominierten Clubs und über die Absprachen unter den Juroren.
Land des Lächelns, Luna di Venezia, Songe d’une nuit d’été, Madame Butterfly, Caprice, Grande Soirée – diese klingenden Namen verweisen auf keine Oper oder Operette, auf kein Theaterstück, kein Sonett, sondern auf die Werke einer anderen Kunstgattung, die ebenfalls auf eine Welt der großen Illusion hindeuten: Haarkreationen von meiner Mutter, von ihr erschaffen in den 50er und 60er Jahren, als die Frisurkunst noch den gleichen Stellenwert wie die Haute Couture hatte und in demselben Maße gefeiert und beachtet wurde.
Vielleicht waren es ihre Hände, die mich als Kind als allererstes faszinierten, langgliedrig und schlank, die Finger zu zart für die schweren Ringe mit dem Staatswappen, die ihr im Jahresrhythmus vom Bürgermeister der Stadt Wien als Anerkennung ihrer Leistungen überreicht wurden. Sie trug die Fingernägel rot lackiert, aber das war ein Detail, verglichen mit dem, was diese Hände hervorzuzaubern imstande waren. Ausdrucksstark und agil haben sie das Zarteste an einem Menschenkörper zu formen gewusst: Das Haar.
Das Leichte, das ihren Frisuren eigen war, spiegelte sich in den Bewegungen ihrer Finger wieder, die in einem einzigen Schwung eine Locke oder ein Passé in die von ihr vorbestimmte Richtung entließen. Und diese schwerelose Geste täuschte über die vorangegangene Knochenarbeit, über das nächtelange Training an einer Frisur hinweg.
The erotic flair of a business woman
Meine ersten Erfahrungen mit Weiblichkeit und Frausein orientierten sich natürlich an ihr, einer Mutter, die strahlend und schick und immer topmodisch gekleidet war, mir jedoch vermittelte, dass diese Schönheit nichts mit Müßiggang zu tun hatte. Die Feste, Bälle und Empfänge, für die sie sich, gemeinsam mit meinem Vater am Abend zurechtmachte besuchte sie nie als träges Luxusweibchen sondern als gefeierte Akteurin des gesellschaftlichen Spiels. Ihre Kleider, die stets dem „dernier cri“ entsprachen unterstrichen ihr Auftreten als Gestalt in der medialen Öffentlichkeit und waren nicht bloßer Selbstzweck und Aufputz. Mit einem solchen Idol vor Augen konnte ich mir lange nicht vorstellen, dass eine Frau nicht „ihren Mann“ im Berufsleben stellte, nicht kreativ war, nicht alles unternahm, um ein, von ihr lanciertes Projekt durchzuziehen.
Demnach hatte ich schon im Alter von neun Jahren meine erste „feministische“ Diskussion. Vor einer, in Schweigen erstarrten Schulklasse stritt ich mich mit einer Kameradin, die für „Frauen zurück an den Herd“ plädierte und behauptete, dass aus Kindern von berufstätigen Müttern nichts werden könne. Nie, sagte ich, könnte ich eine Mutter ertragen, die im Leben nichts anderes zu tun hätte als bei meinen Hausaufgaben hinter mir zu stehen und mich zu überwachen. Ich fand es faszinierend, auf Mama zu warten, wenn sie von einer Tournee aus Stockholm oder London zurückkam und uns für die damalige Zeit exotisches Spielzeug von ihren Reisen mitbrachte. Ich erinnere mich an ein Stammbuch in der Form einer Malerpalette aus Schweden, auch an eine Kassette mit mindestens siebzig Caran d’Ache Buntstiften aus der Schweiz.
Ich hatte eine Mutter, die zwar selten über Kochrezepte sprach, dafür aber über eine in einer Frisur vergessene Haarnadel todunglücklich war, weil diese Nadel sie um den ersten Platz bei einer Meisterschaft brachte. Bei uns zu Hause waren Clips und Wickler, Haarsprays und Festiger überall und trotzdem war manchmal in der ganzen Wohnung kein Kamm aufzutreiben. So diszipliniert, perfektionistisch und unermüdlich meine Mutter an ihren „Creationen“ arbeitete, gerade bei diesen so wichtigen Utensilien herrschte das Chaos.
1962, als ich im Alter von sieben Jahren anfing nachzudenken, hatte meine Mutter das Preisfrisieren bereits hinter sich gelassen, und von den zauberhaften Gebilden auf den Köpfen der Mannequins waren nur mehr Reste übrig und Fotos, die wir bewundern durften. Die Schubladen unserer Schränke glichen dem Fundus eines Theaters: leuchtende Strass Sterne und weißglitzernde, spinnennetzfeine Agraffen, ein blaues Diadem – nach ihren Wünschen und Vorgaben von Swarovski angefertigt; Schärpen und Fächer, Brokatkleider und Taftbahnen, Haarteile, sogenannte Postische in verschiedensten Farben, die einst zu wahren Wunderwerken zusammengebaut waren und jetzt neben den Schulheften lagen.
Die Kindheit von meiner Schwester Gabi und mir spielte sich zwischen unserer Wohnung im ersten Stock und dem darunterliegenden Frisiersalon ab. Damit wir Mama immer erreichen konnten, hatte unser Telefon eine Direktleitung zum Geschäft hinunter. Wenn wir den roten Knopf neben der Wählscheibe drückten, wurden wir sofort mit Mama verbunden. Das gab uns die Illusion, sie immer in unserer Nähe zu haben.
Der Salon (der erste der fünf, die meine Eltern innerhalb von zehn Jahren aufgebaut hatten) war respekteinflößend genug. Von einem Architektenduo im Stil der 50er Jahre durchgestylt (auch ein kleiner Wintergarten mit Papagei durfte nicht fehlen) war er untertags ein Treffpunkt der Damen der Wiener High Society, zu denen wir höflich sein mussten, und die von meinem Vater, der an der Kassa stand, mit „Küss die Hand, Gnädige Frau“ zur Tür begleitet wurden. Die Opernsängerin Teresa Stich-Randall flog vor ihrem Auftritt in London nach Wien, um sich von meiner Mutter frisieren zu lassen.
Am Abend war das Geschäft ein verwunschenes Paradies mit wertvollen Schätzen, angefangen von den Tüllnetzchen, die den Kunden unter der Trockenhaube aufgesetzt wurden, über Hunderte von Lockenwicklern, Spitzenumhängen, Taft- und Lackdosen, Samthaarreifen, Ohrclips und Spangen bis zu den unzähligen Artikeln der Parfumerie, die mein Vater führte. Noch geheimnisvoller aber war das Magazin im hinteren Teil des Geschäftes, das nur über eine Leiter zu erreichen war. Dort häuften sich alte Auslagendekorationen, Seidenstoffe, spiegelummantelte Sockel, auf denen Parfums ausgestellt worden waren, Neoninschriften – dort konnten wir uns stundenlang vor der Erwachsenenwelt verstecken. Da ich schon als Kind mit Nagellacken, Duftwässern, Puderdosen, Lippenstiften und den teuersten Hautcremes spielen durfte, hat die Kosmetikindustrie in meinem Erwachsenenleben ihren Nimbus völlig verloren und ich verfiel ihrer Werbung nie.
Meine Mutter herrschte in diesem Reich wie eine moderne Jeanne d’Arc, unschuldig aus dem Nichts gekommen und mit einer Sendung betraut, an die sie ohne je daran zu zweifeln glaubte, war sie unermüdlich dabei, sich dieser Aufgabe so gut wie möglich zu entledigen, und zog ein Heer von Kundinnen, Mannequins, Angestellten, Journalisten, Photographen, Kameraleuten und Branchenkollegen in ihren Bann. Mit ihrer Perfektion konnte ohnehin niemand mithalten. In Spitzenzeiten frisierte sie einhundertzwanzig Kunden am Tag. Am Abend musste sie zu Veranstaltungen, und jedes Wochenende flog sie auf Tournee. In den siebziger Jahren besaß sie gemeinsam mit meinem Vater fünf Geschäfte mit dreiundvierzig Angestellten – im Stammgeschäft allein waren es achtzehn. Ich frage mich jetzt rückblickend, wann sie eigentlich geschlafen hat.
Das Märchen von dem Mädchen mit den goldenen Händen
„Was Louise Rick auch immer anfasst, es wird zu Gold”, sagte einmal der Leiter der österreichischen Friseurinnung, und die Lebensgeschichte meiner Mutter hört sich an wie eine Abwandlung der Erzählung vom Tellerwäscher, der zum Millionär wurde.
Tochter einer alleinstehenden, mittellosen Zugehfrau, kam sie 1925 zur Welt und wuchs mit fünf anderen Kindern in der Zimmer-Küche-Wohnung der Großmutter auf. Ihr erstes eigenes Paar Schuhe bekam sie auf wiederholtes Ansuchen im Alter von zwölf von der Fürsorge geschenkt. Ihr Traumberuf war Lehrerin, ein Stipendium für das Gymnasium hätte sie auf Grund ihrer guten Noten bekommen, aber das Geld zu Hause war knapp und an Studieren war nicht zu denken. Als sie mit vierzehn aufs Arbeitsamt ging, erhoffte sie sich wenigstens einen Posten als Sekretärin. „Statt dessen“, erzählt sie, „kam ein Ehepaar auf mich zu und sprach mich an, ob ich als Friseurlehrling bei ihnen beginnen wolle. Ich sagte entsetzt nein, ich wolle nicht mein Leben lang die Haare fremder Leute schlucken. Die beiden waren enttäuscht, sie hätten mich nun eine Stunde lang beobachtet, und ich hätte ihnen von allen Arbeitssuchenden am besten gefallen. Sie gaben mir trotzdem ihre Adresse.”
Am nächsten Tag nahm Louise Rick, damals noch Aloisia Sedlacek, das Angebot an – denn die einzige andere, freie Stelle wäre die einer Verkäuferin gewesen. „Da hätte ich schon gar nichts gelernt.” Die Lehrzeit absolvierte sie fleißig in zwei anstatt in drei Jahren. Dann wurde sie zum Wetterdienst eingezogen. Mit einer Freundin flüchtete sie bei Kriegsende nach Bad Gastein.
„Ich frisierte zuerst eine Hotelbesitzerin und bekam dafür Quartier – ein Dachkammerl, in das es hineinregnete. Bald jedoch hatte ich die ganze Hotellerie und alle Geschäftsleute als KundInnen und bekam von den diversen Gastwirtschaften Einladungen, so hatten wir täglich etwas zu essen. In Wien war es in dieser Zeit so trostlos, dass der Friseurberuf keine Chancen gehabt hat. Ich bin zwei Jahre in Gastein geblieben.”
Als sie nach Wien zurückkehrte, gab es immer noch keine Möglichkeit, mit dem Frisieren Geld zu verdienen. Man bot ihr einen Job als Kassiererin in einem Restaurant an, in dem die französischen Besatzungsmächte verkehrten, und sie begann, französisch zu lernen. Aber das Frisieren ließ sie nicht mehr los.
„Eines Tages ging ich als Zuschauerin zu einem Preisfrisieren ins Auge Gottes – ein Kino mit einem großen Veranstaltungssaal. Es war das erste Preisfrisieren nach dem Krieg und es war so wunderschön für mich, dass ich richtig Herzklopfen bekam und mir dachte, ich muss es in diesem Beruf zu etwas bringen. Mach die Meisterprüfung, dachte ich, man muss etwas einmal Begonnenes auch fertigmachen. Ich ging von den Franzosen weg und suchte mir eine Stellung bei einem Friseur. Kaum war ich angestellt, meldete ich mich sofort zum nächsten Preisfrisieren an. Es war die österreichische Staatsmeisterschaft in der Wiener Börse, und ich kam auf den 10. Platz. Ich war die jüngste Teilnehmerin, 23 Jahre alt, die anderen waren zehn Jahre älter und Profis. Der Preis wurde mir von dem damaligen, heute legendären Bürgermeister Theodor Körner überreicht, der mich wegen meines jugendlichen Engagements lobte. Es war ein Glück, dass ich da hineingerutscht bin, ich gehörte noch zu keinem der Clubs, die ihre Zugpferde zu den Bewerben schickten. Das nächste Mal landete ich bereits auf Platz fünf. Damit konnte ich mich für die Akademie der Friseurkunst Österreichs qualifizieren. Es gab ja drei wichtige Clubs, die Preisfriseure heranzüchteten, die Akademie war der bedeutendste. Was mich an diesen Wettbewerben faszinierte, war das Künstlerische der Frisuren, die Perfektion, jedes Haar musste millimetergenau sitzen, ich musste unter Zeitdruck das Beste geben. Wenn ich auf dem Laufsteg stand und frisierte, verschwand die übrige Welt um mich herum. Ich vergaß Preisrichter, Konkurrenten, Kollegen und das Publikum. Das war ein berauschendes, tolles Gefühl. Ich bin ja eine Kämpfernatur. Ich musste unbedingt gewinnen.”
Aber damals wurde sie von den ganz Großen noch gar nicht beachtet. „Da bin ich vor deren Auslagen gestanden und hab mir ihre Postische angeschaut und bin dann nach Hause und hab nach Geschäftsschluss, das war neun, zehn Uhr abends, bis weit nach Mitternacht trainiert und geübt und trainiert und geübt. Und erst nach und nach sind sie auf mich aufmerksam geworden.”
Das haarfeine Leuchten des Sommernachtstraums
Der große Durchbruch gelang ihr bei den Österreichischen Bundesmeisterschaften im Schlosshotel Velden am Wörthersee mit einer Frisur aus fast transparenten Haarglöckchen, in die winzige Glühbirnen eingebaut waren, die auf dem Laufsteg zu leuchten begannen – der Sommernachtstraum.
„Das Aufregende war, dass die Lämpchen bei den Proben streikten, und ich mich schon mit allem abfand. Als aber die Jury zur Bewertung kam, fingen sie wie durch ein Wunder doch zu leuchten an, und das war DIE Sensation. Die Leute im Saal applaudierten wie verrückt. Und das brachte mir den Bundesmeistertitel ein.“
Das Wunderteam und der Coup Mondial
„Danach”, erzählt sie, „schickte mich die Bundesinnung der Friseure im österreichischen Nationalteam nach Brüssel zu meiner ersten Weltmeisterschaft. Wir waren zu fünft: Franz Tomek, Franz Hruska, Heinz Kammerer, Karl Danzinger (mein vormaliger Chef) und ich – einzige Frau und auch die Jüngste. Ich war national die Höchstpunktierte unter meinen Kollegen – die Punkte werden ja wie beim Sport nach den gewonnenen Bewerben zusammengezählt – und so mussten sie mich einfach mitnehmen.
Wir haben in Brüssel den zweiten Preis gemacht. Zwei Jahre später sind wir in Brighton die Ersten geworden, dann in Wien, dann in Köln. Man hat uns „das Wunderteam“ genannt, weil wir dreimal hintereinander die Franzosen geschlagen haben, als erstes Team der Welt. Man muss sich das vorstellen, sechs Jahre hindurch waren die Franzosen hinter den Österreichern die zweiten.“
Land des Lächelns – eine Frisur, leichter als Zirruswolken am Himmel
Obwohl der Weltmeistertitel nur im Team erworben werden konnte – denn es wurden die Punkte der einzelnen Teammitglieder zu einem Gesamtergebnis zusammengezählt erlangten die Frisuren der einzelnen Disziplinen als solche große Beachtung. Die Frisur, mit der Louise Rick die höchste Punktewertung in der Disziplin Phantasie errang und die den poetischen Namen „Land des Lächelns” trug, ging durch alle Zeitungen.
„Land des Lächelns” war fast keine Frisur im herkömmlichen Sinn mehr. Sie war leichter und duftiger als Zuckerwerk und weniger real als eine Luftspiegelung. Auf wattefeinen, pastellgetönten weichen Dauerwellen schwebten Federn mit Rosé-Effekt, so zart, dass sie der Schwerkraft zu trotzen und jeden Moment davonzufliegen schienen.
„Die rosa-schwarzen Federn dieser Frisur‘“, erzählt meine Mutter, „sind natürlich auch aus Haaren gemacht. Ich habe sie selber geknüpft und eingefärbt und auf einer Glasunterlage montiert, bevor ich sie abnahm und als Federn in die Frisur einarbeitete.“
„Ich habe mir bald auch die Wickler, über die die Haare eingedreht wurden, aus Glas blasen lassen. Normalerweise waren Haarwickler ja aus Maschendraht oder Plastik. Aber die glatte Oberfläche des Glases, über die das noch nasse Haarpassé eingerollt, im Fachjargon „eingelegt“ wurde, erlaubte ein präziseres Arbeiten. So konnten die Haarspitzen keinen Bug bekommen. Das hat außer mir niemand gemacht. Ein Journalist hat einmal die Frage gestellt, warum meine Wickler aus Glas seien. Damit ich sie nicht aufheben muss, wenn sie hinunterfallen, habe ich geantwortet.”
Auf dem Foto in der Zeitung ist neben der Frisur auch seine Schöpferin zu sehen, Louise Rick mit zwei überdimensionalen Pokalen in der Hand und ihrem so typischen Lächeln: strahlend, ohne Effekthascherei und arglos, als wäre alle Unbill der Welt an ihr spurlos vorübergegangen, sie selbst ganz mit sich im Reinen. Als hätte sie das Leben eben erst jetzt entdeckt.
In den Zeiten zwischen den Weltmeisterschaften bestritt meine Mutter andere Wettbewerbe – und gewann. Es regnete weitere Auszeichnungen, Pokale und Medaillen. 1960 bedachte sie die Republik mit dem österreichischen Staatspreis für Verdienste um die Weltgeltung der österreichischen Frisur. Die Kammer der gewerblichen Wirtschaft überreichte die silberne Ehrenmedaille. Die Stadt Wien verehrte ihr Diplomatengeschenke: Rosenkavalier und Levade aus Augartenporzellan. Die Friseurinnung eine goldene Brosche mit Lorbeerkranz. Jeder der vier Prominentenclubs ernannte sie zum Ehrenmitglied und vergab goldene Ehrennadeln, – kreuze, – abzeichen und -kämme.
Bei den Wettbewerben allein blieb es nicht. Das Team ging auf Tourneen. Doch eines Tages hatte Louise Rick genug davon.
Die Trendsetterin
„Ich stieg aus dem Preisfrisieren aus und widmete mich der Modefrisur, den sogenannten ‚Creationen’. Das ist wie Haute Couture. Zweimal im Jahr werden die ‚Creationen’ der besten Friseure vorgestellt, die die Haarmode beeinflussen, und damit hatte ich auch beim breiten Publikum meine ersten großen Erfolge. Ein guter Preisfriseur muss ja nicht unbedingt im Modefach brillieren. Preisfrisieren ist oft abstrakt und künstlerisch, nicht immer tragbar.”
Ihre Karriere als Modefriseurin begann noch während der Wettbewerbe, als sie zweimal den Modering der Stadt Wien errang - eine Auszeichnung, die demjenigen verliehen wurde, der die Frisurenmode eines ganzen Jahres nachhaltig prägte. Die vom Modering gekrönte Tagesfrisur setzte einen Trend, der international aufgenommen und nachgeahmt wurde. Es war eine Frisur, die danach alle Salons in ihren Auslagen hatten, ähnlich einer Modekreation von Dior. Sie kam zuerst in die Fachpresse, dann wurde sie von den großen Zeitungen verbreitet. Natürlich hat zuerst die Fachwelt sie beurteilt und nachgemacht.
Der Modering wurde von dem Komitee „Internationale Frisur und Mode” gestiftet und musste im Rahmen des Grand Prix von Wien erkämpft werden. Es ging darum, in einem eng gesteckten Zeitlimit, in zwanzig Minuten die schönste Tagesfrisur zu gestalten. Wie bei allen anderen Meisterschaften kam man auch hier mit einem Model auf den Laufsteg, dessen Haare bereits in der Linie, an der man zuerst trainiert hatte, eingelegt waren und die dann innerhalb von zwanzig Minuten auffrisiert wurden.
Viele Male hatten meine Schwester und ich die Geschichte dieses Moderinges gehört, der für uns mehr Macht ausstrahlte, als der Ring der Nibelungen und dessen unangefochtene Trägerin unsere Mutter war.
„Niemand”, so erzählte sie uns, als wir noch klein waren, „hat damit gerechnet, dass ausgerechnet eine Frau diesen Ring gewinnen wird, und so hatte er das typische Aussehen eines Männerringes: schweres Gold, eine viereckige, protzige Form und den Adler der Republik auf schwarzem Grund. Als ich ihn zum ersten Mal überreicht bekam waren sie etwas betreten und sagten, aber jetzt ändern wir seine Form auch nicht mehr. Ein Jahr später haben sie gedacht, na, ein zweites Mal gewinnt Louise Rick ihn ohnehin nicht, und schon hatte ich wieder einen Männerring am Finger. Im dritten Jahr haben sie ihn als Auszeichnung dann aufgelassen.”
Die Erfolgswelle riss nicht ab. Einladungen ins Ausland folgten – zu Kongressen, die von Firmen wie L’Oréal, Wella und Schwarzkopf organisiert wurden und an denen bis zu 24 Nationen teilnahmen, zu Weltkongressen der Friseurinnungen und Kreativclubs. Meine Mutter flog meistens allein, mein Vater blieb mit uns Kindern zurück.
Neben jeder erfolgreichen Frau…
Gemeinsam mit meinem Vater eröffnete meine Mutter ein Geschäft nach dem anderen, aber noch bevor es soweit kam, musste Herbert Rick miterleben, wie unfair Männer sein können, wenn sie Frauen nicht hochkommen lassen wollen. Keiner ihrer Chefs, kann man sagen, hat meine Mutter wirklich unterstützt, eigentlich hat jeder versucht ihr Prügel zwischen die Beine zu werfen.
Mein Vater, der Nicht-Friseur hatte sich in dem Fachgebiet seiner Frau sehr viel Wissen angeeignet, und ohne ihn hätte sie höchstens eines ihrer vielen Geschäfte eröffnen und führen können. Nur mit ihm als Partner konnte sie ihre Erfolge zu Geld machen. Er hat sich also ganz mit ihrem Leben und ihrer Arbeit identifiziert.
1952 eröffneten beide ihren ersten großen Salon in dem Wiener Innenstadtbezirk Josefstadt. Und drei Jahre später kam ich auf die Welt. Da die Wohnung im ersten Stock bei meiner Geburt noch nicht frei war, verbrachte ich meine ersten Lebenstage im Frisiersalon meiner Eltern, umhegt von einer Legion von Kundinnen, Angestellten und neugierigen Nachbarn des Bezirkes, der in den Fünfzigern einen noch sehr dörflichen Charakter hatte. Jeder kannte jeden. Eineinhalb Jahre später wurde meine Schwester Gabi geboren und wir wurden auf jeder Veranstaltung, an der meine Mutter teilnahm, als die „Töchter der Weltmeisterin“ vorgestellt, von entzückten Fans meiner Mutter umarmt und abgeküsst.“
Meine Mutter war ein ausgesprochener Familienmensch und ihre Loyalität und Großzügigkeit uns Kindern gegenüber war grenzenlos. Aber ihre Fürsorglichkeit übertrieb sie. Immer kämpfte sie gegen den schlechten Ruf ihres Berufes an, und wir Kinder durften nicht auf Abwege geraten. Auf Anraten einer ihrer Kundinnen, einer Gräfin, schickte sie uns in eine französische Klosterschule. Sie mochte es nicht, dass wir uns schminkten und weigerte sich, uns die Haare zu färben oder uns einen modischen Schnitt zu verpassen, uns also in irgendeiner Weise „aufzudonnern“. Davon hatte sie in ihrem Beruf genug. Mit diesen Erinnerungen vor Augen träume ich immer wieder von ihren Tricks mit den Glitzerbürsten und höre die bewundernden Worte ihrer Kollegen: ‚Louise Rick – das ist Zauber und Chachacha.’
Erschienen in: Mit Haut und Haar, Ausstellungskatalog, Wien Museum 2018